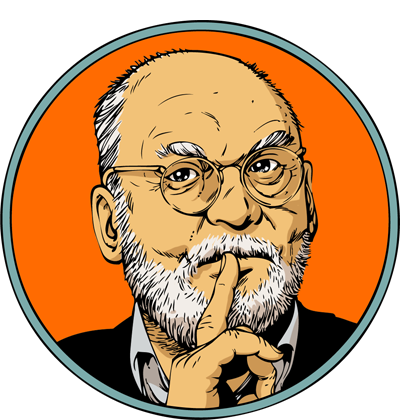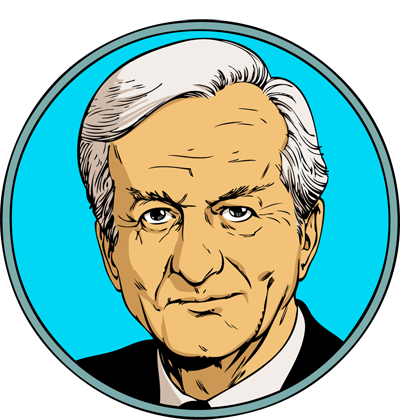Ihr Vater zog 1953 mit seiner Frau aus West- nach Ostdeutschland, um der damaligen Pfarrernot in der DDR zu begegnen. Zwei Jahre später erblickte Friederike das Licht der Welt. Ihre Großmutter Ester von Kirchbach war eine erfolgreiche Schriftstellering und engagierte sich im Dritten Reich in der Bekennenden Kirche. Die Bundespost ehrte sie 2002 mit einer Briefmarke in der Serie "Berühmte Frauen". Die Enkelin bedauert es ein wenig, dass mit ihrer Großmutter keine Briefe mehr frankiert werden – weil es die Dauerserie nicht mehr gibt und sich die Portowerte verändert haben.
Aber auf den Widerstand der Großmutter ist Pröpstin von Kirchbach auch heute noch stolz. Die Erinnerung daran gibt ihr Kraft, sich gegen Rechts zu engagieren. Dabei ist es ihr wichtig, nicht nur an die rechten Jugendlichen zu denken, sondern auch (und vor allem) an deren Eltern. Denn oft werde das rechte Gedankengut in den Familien gesät. Deshalb dürfe man die Erwachsenen im Kampf gegen Rechts nicht außen vor lassen.
Viele engagieren sich für kirchliche Dinge
Auch der Kampf zwischen den Kirchen und dem Staat um den Religionsunterricht in Berlin ist noch nicht ausgetragen. Lebenskunde ist Pflichtfach, Religionsunterricht freiwillig. Haben die Kirchen die Niederlage verkraftet? Für Pröpstin von Kirchbach ist zunächst einmal wichtig: "Die Teilnehmerzahlen am freiwilligen evangelischen Religionsunterricht sind nicht zurückgegangen." Und sofort fügt sie hinzu: "Wir bemühen uns auch, die besten Lehrer und Pfarrer für diesen Unterricht zu gewinnen." Gleichzeitig probiert man aus, ob es auch Möglichkeiten der Kirche für eine Mitarbeit im Lebenskundeunterricht gibt. Das ist ein Test - ob er sich bewährt, ist völlig offen.
Hauptgegner gegen ein von den Kirchen unterstütztes Wahlpflichtfach Religion/Ethik ist der Humanistische Verband, der jedoch nach Überzeugung der Pröpstin von Kirchbach nur für eine "kleine Gruppe" steht. Die Mehrheit der Berliner und Brandenburger sei zwar konfessionslos, das bedeute aber noch lange nicht, dass sie hinter dem Humanistischen Verband stehe. Vielmehr ist die Konfessionslosigkeit in erster Linie ein Ausdruck dafür, dass sich die Menschen wenig für Gott interessieren. Trotzdem engagieren sich viele für kirchliche Dinge.
Etwa für die Erhaltung von Gotteshäusern, die gerade in den neuen Bundesländern vielfach vom Verfall bedroht sind. Frau von Kirchbach schätzt, dass rund 60 Prozent der Menschen, die sich in Berlin und Brandenburg für den Erhalt und die Sanierung von Kirchen und Kapellen engagieren, keiner Kirche angehören. Dieses Engagement habe für die Gesellschaft eine große Bedeutung und die Kirche sei dafür sehr dankbar.
Drohender Pfarrermangel
In der Öffentlichkeit ist das Ansehen der Kirchen nicht immer gut, häufig gibt es negative Schlagzeilen. Die Pröpstin sieht die Kirche aber in einem nicht ganz so schlechten Licht: Zum einen erfahre die Kirche gerade auch in einem Gebiet wie Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, wo sie in der Minderheit sei, eine große Anerkennung für viele ihrer Dienste – etwa im Krankenhaus oder Gefängnis. Frau von Kirchbach: "Da können die Medien schreiben, was sie wollen. Die Menschen wissen aus eigener Erfahrung, dass die negativen Schlagzeilen nicht die Wahrheit abbilden."
Immer wieder ist die Pröpstin erstaunt, "wie offen die Menschen uns als Kirche gegenüber begegnen." Allerdings hätten viele Menschen gar keine Kenntnis von dem, was die Kirche alles leiste. Und so verstehe sich die Kirche auch weiterhin als Volkskirche, zumal sie den Anspruch nicht aufgebe, "Kirche für andere" zu sein. Das sei auch schon zu Zeiten der DDR nicht anders gewesen.
Immer mehr Landeskirchen klagen über einen drohenden Pfarrermangel. Auch Pröpstin von Kirchbach ist diese Sorge nicht unbekannt – obwohl die Evangelisch Theologische Fakultät der Berliner Humboldt-Universität mit rund 1000 Studierenden die größte in Deutschland ist. Frau von Kirchbach erinnert daran, dass um 2020 eine große Pensionswelle auf die EKBO zukommt. Zwar werde die EKBO im Blick auf den Nachwuchs von den großen Studierendenzahlen der Humboldt-Universität profitieren. Ob das ausreiche, sei aber ungewiss.
Außerdem besolde die EKBO die Pfarrer nach A 13 Ost, was viele junge Theologen abschrecke - in anderen Landeskirchen würden sie besser bezahlt. Wichtig sei, dass sich die Kirche rechtzeitig Gedanken über den Nachwuchs mache. Und man sehe ja, dass auch die westdeutschen Landeskirchen, die besser bezahlten, einen erheblichen Pfarrermangel in naher Zukunft nicht ausschließen würden.
Ein gutes Zeichen: Menschen treten in die Kirche ein
Welche Zukunft hat die Kirche in Berlin? Für Pröpstin von Kirchbach ist die Antwort eindeutig: "Die Kirche wird auch in Zukunft gebraucht." Nicht zuletzt für die Feier- und Erinnerungskultur, für die Kirchenmusik, und selbstverständlich auch für die vielen Menschen, die Wert auf Gottesdienst, Seelsorge und Diakonie legten. Andererseits dürfe man nicht übersehen, dass Berlin jeden Tag etwa 2000 Veranstaltungen anbiete. Da sei die Konkurrenz also schon sehr groß. Voraussetzung für die Attraktivität kirchlicher Veranstaltung sei es freilich, "dass wir gute Arbeit leisten."
Sorgen bereitet die Situation in vielen ländlichen Regionen der Landeskirche, etwa in Brandenburg. Dort gebe es bereits jetzt "weiße Flecken". Für die Pröpstin ist es allerdings ein gutes Zeichen, dass pro Monat nicht nur zwischen 500 und 600 Menschen die Kirche verlassen, sondern auch 100 bis 220 wieder in sie eintreten. Trotzdem werde man wohl auf Dauer nicht umhinkommen, in den Regionen mit wenigen Christen kirchliche Zentren zu schaffen. Bereits heute sei die Belastung zahlreicher Pfarrer "sehr groß".
Und die Belastung der Pfarrerinnen erst recht. Man müsse sehen, dass es gerade jüngeren Theologinnen schwer falle, Pfarramt und Familie in Einklang zu bringen, sagt Friederike von Kirchbach. Lachend fügt sie hinzu: "Das protestantische Arbeitsethos erfordert wohl auch von den Frauen einen überquellenden Terminkalender." Darf man fragen, auf wie viel Wochenstunden die Pröpstin von Berlin, Mutter dreier erwachsener Kinder, kommt? Die Antwort ist ebenso knapp wie beängstigend: "60 Stunden."