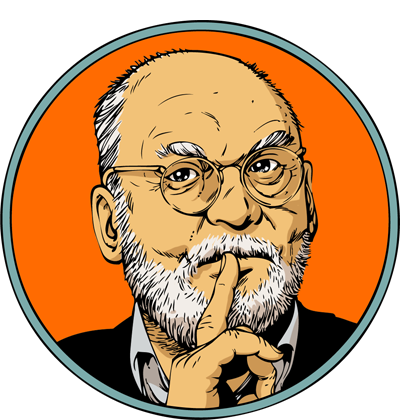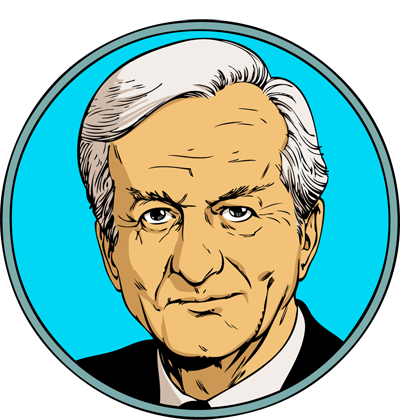Foto: Getty Images/amana images RF/DAJ
Donald Trump steigt aus dem Pariser Klimavertrag aus, weil er sich davon Vorteile für die US-Kohlewirtschaft verspricht.
Nach der Abkehr der USA vom Pariser Klimavertrag haben mehrere wirtschaftsstarke Länder ihre Zusagen zum Kampf gegen die Erderwärmung bekräftigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärte am Freitag, die Entscheidung werde alle, die sich dem Schutz der Erde verpflichtet fühlten, nicht aufhalten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnte, US-Präsident Donald Trump begehe einen Fehler, der den Interessen seines Landes und des Planeten schaden werde. Am Nachmittag wollten sich die EU und China bei einem Gipfel in Brüssel zu ihrer Verantwortung für den Klimaschutz bekennen.
Trump hatte den Rückzug der USA vom Pariser Klimaabkommen am Donnerstag (Ortszeit) im Rosengarten des Weißen Hauses angekündigt. Zur Begründung sagte er, das Klimaabkommen benachteilige die Vereinigten Staaten. Es vernichte Jobs in der US-amerikanischen Kohleindustrie. Während China und Indien ihren Treibhausgasausstoß weiter steigern dürften, müssten sich die USA einschränken, beklagte er. Zugleich bot der US-Präsident an, das Abkommen neu zu verhandeln.
Merkel betonte: "Entschlossener denn je werden wir in Deutschland, in Europa und in der Welt alle Kräfte bündeln, Menschheitsherausforderungen wie die des Klimawandels aufzunehmen und erfolgreich diese Herausforderung zu bewältigen." In einer gemeinsamen Erklärung erteilten Merkel, Macron und der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni dem Vorschlag Trumps, den Vertrag nachzuverhandeln, eine klare Absage.
"Katastrophe für die ärmsten Menschen"
Auch weite Teile der US-Industrie lehnen den Schritt Trumps ab. Vertreter amerikanischer Großkonzerne, darunter Microsoft, Coca Cola, Tesla, ExxonMobil, Dow Chemical und Apple, hatten Trump in den vergangenen Tagen dazu gedrängt, das Abkommen nicht zu verlassen.
Mit scharfer Kritik reagierten auch Umwelt- und Entwicklungsorganisationen. "Der von Präsident Trump verfügte Ausstieg aus dem Paris-Abkommen ist ein Schlag ins Gesicht der gesamten Menschheit, und er schwächt die USA selbst", sagte Klaus Milke, Vorstandsvorsitzender von Germanwatch. Oxfam sprach von einem "üblen Fußtritt für den globalen Klimaschutz". Nach Auffassung von "Brot für die Welt" ist der US-Ausstieg eine "Katastrophe für die ärmsten Menschen".
Auch die Kirchen in Deutschland verurteilten den Schritt des US-Präsidenten und forderten die internationale Gemeinschaft auf, im Kampf gegen die Erderwärmung nicht nachzulassen. "Insbesondere die Europäer sind aufgefordert, geschlossen eine Vorreiterrolle bei der Bewahrung der Schöpfung einzunehmen", betonte der Vorsitzende katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Marx. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, erklärte: "Die Zukunft gehört einem Lebensstil, der allen Menschen auf der Erde und auch kommenden Generationen ein würdiges Leben ermöglicht."
Die Kündigung des Vertrages greift formell frühestens 2020. Allerdings sind die darin enthaltenen nationalen Ziele zur CO2-Minderung von jedem Land selbst gesteckt und rechtlich nicht bindend. Trump kündigte an, dass die Zusagen der USA ab sofort nicht mehr gelten. Auch an der Finanzierung des sogenannten Green Climate Funds zur Unterstützung von Entwicklungsländern im Kampf gegen die Erderwärmung will sich Trump nicht mehr beteiligen. Die USA sind nach China der zweitgrößte Produzent von Treibhausgasen weltweit.
In dem Vertrag hatten sich die Staaten bei der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 dazu verpflichtet, die Erderwärmung auf weit unter zwei Grad, wenn möglich sogar auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Dafür sollen die Treibhausgasemissionen deutlich reduziert werden. Außer Syrien und Nicaragua haben alle Länder den Vertrag unterzeichnet.
Das Klimaabkommen von Paris
Das Klimaabkommen von Paris wurde Ende 2015 von 194 Ländern verabschiedet. Es ist der erste internationale Vertrag, der alle Staaten zum Kampf gegen die Erderwärmung verpflichtet. Inzwischen haben 147 Länder die Übereinkunft ratifiziert - sie ist damit in Kraft. Nach ihrem Ausstieg werden die USA neben Syrien und Nicaragua einer von drei Staaten sein, die dem Abkommen nicht angehören.
In dem Vertrag setzen sich die Staaten das Ziel, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter deutlich unter zwei Grad Celsius, wenn möglich sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts sollen die "Netto-Emissionen" auf null sinken - es soll also ein Gleichgewicht erreicht werden zwischen dem menschgemachten Ausstoß von Treibhausgasen und der CO2-Bindung durch sogenannte Senken, das sind etwa Wälder.
Die festgehaltenen nationalen Ziele zur Minderung der Treibhausgase sind von jedem Land selbst gesetzt und rechtlich nicht bindend. Verpflichtet sind die Staaten indes dazu, Transparenzregeln einzuhalten und Forschrittsberichte abzugeben. Die selbstgesteckten Ziele müssen alle fünf Jahre überprüft und verschärft werden. Das Abkommen sieht auch finanzielle Hilfen für arme Staaten im Kampf gegen den Klimawandel vor.